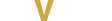Jodeln ist Singen ohne Text auf Lautsilben bei häufigem schnellen Umschlagen zwischen Brust- und Falsettstimme (Registerwechsel). Das davon abgeleitete Wort Jodler bedeutet entweder „was geschieht, wenn jemand jodelt“ (Nomen Actionis) oder es bezeichnet „einen Menschen, der jodelt“ (Nomen Agentis).
Der Stamm des Wortes „jodeln“ ist lautmalerisch, ebenso wie der Stamm des Wortes „johlen“. Üblich sind Silbenfolgen wie beispielsweise „Hodaro“, „Iohodraeho“, „Holadaittijo“ und viele andere. Kennzeichnende Merkmale des Jodelns sind auch grosse Intervallsprünge und weiter Tonumfang.
Nicht zu verwechseln ist der Jodler mit dem Juchitzer (Juchzer), einem kurzen, melodiösen Schrei, wobei der Juchitzer in den Jodler übergehen kann, und wohl auch dessen Stammform bildet.
Ursprünge
In wahrscheinlich allen gebirgigen und unwegsamen Regionen der Welt gibt es verschiedene Techniken, um mit Rufen weite Distanzen akustisch zu überbrücken. Die Ursprünge des Jodelns gehen auf vorhistorische Zeiten zurück: Jodelnd verständigten sich Hirten und Sammler, Waldarbeiter und Köhler. Nicht nur in den Alpen wurde von Alm zu Alm mit Almschrei (Almschroa) oder Juchzer (Juchetzer, Jugitzer, Juschroa) kommuniziert oder auch das Vieh mit einem Jodler (Viehruf) angelockt.
Joseph Ratzinger (in Bayern aufgewachsen) vermutet, der bedeutende Theologe Augustinus von Hippo habe das Jodeln gemeint, als er vom Jubilus schrieb, einer „Form wortlosen Rufens, Schreiens oder Singens“, das „wortlose Ausströmen einer Freude, die so gross ist, dass sie alle Worte zerbricht.“ Jubili hiessen später auch rituell festgelegte Melismen des Gregorianischen Chorals.
Verbreitung
Jodel-Kommunikationsformen existieren bei den afrikanischen Pygmäen (mokombi), bei den Eskimos, im Kaukasus, in Melanesien, in Palästina, China, Thailand und Kambodscha, in den USA, Spanien (alalá), in Sápmi (Lappland) (joik, auch juoigan), in Schweden (kulning, auch kölning, kaukning), Polen, Slowakei, Rumänien, Georgien (krimanchuli), Bulgarien und im Alpenraum.
Der Jodler ist heute oft auch im Rahmen der volkstümlichen Musik zu hören. Zu den bekanntesten bayerischen Interpreten gehört der Jodelkönig Franzl Lang. Im Harz finden jährlich Jodlerwettstreite in Clausthal-Zellerfeld, Altenbrak und Hesserode statt. Jodeln gehört bis heute im Harz zur regionaltypischen Folklore. Auch im Erzgebirge, im Thüringer Wald und im Thüringer Schiefergebirge spielt es eine wichtige Rolle im musikalischen Brauchtum.
Den Weltrekord im (Dauer-)Jodeln hält die Bayerin Andrea Wittmann mit 15 Stunden 11 Sekunden. Einen weiteren Weltrekord hält der Schweizer Peter Hinnen: 1992 erhielt er einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde, als er mit 22 Jodel-Tönen in einer einzigen Sekunde den Weltrekord im Schnelljodeln aufstellte. Den Sprung in die Schweizer Hitparade schafften 2008 Oesch’s die Dritten, nicht zuletzt dank dem stimmakrobatischen „Ku-Ku Jodel“ von Peter Hinnen.
Alpenländisches Jodeln
Im alpenländischen Volkslied wurde der Jodler zum Jodel-Lied musikalisch weiterentwickelt. Hierbei unterscheidet man auch zwischen dem gesungenen Jodler – der nur in Bruststimme und meistens nur in kurzen Sequenzen zwischen den Liedversen gesungen wird – und dem geschlagenen Jodler, bei dem Brust- und Falsettstimme häufig und kunstvoll wechseln. Geschlagene Jodler können sehr lang sein und verlangen regelrechte Stimmakrobatik.
Ursprüngliche Jodler wurden oft solistisch praktiziert, die meisten Jodel-Lieder sind mehrstimmig und scheinen häufig als Kehr- und Schluss-Refrain von Volksliedern auf. Besonders in der Schweiz, aber auch im übrigen alpenländischen Raum hat sich im 19. Jahrhundert eine Pflege des Jodlers in Chören entwickelt. Auch die kirchliche, sakrale Volksmusiktradition, etwa in Südtirol, kennt ein- oder mehrstimmige Jodler. Und auch instrumentale Jodler werden von Kleingruppen gespielt.
Lokale Bezeichnungen sind Wullaza (Steiermark), Almer (Oberösterreich), Dudler (Niederösterreich und Wien), Gallnen (Oberbayern), Ari (Bayerischer Wald), Roller (Oberharz), Zäuerli oder Ruggusseli (Appenzellerland), Naturjutz (Muotathal, Ybrig und Schwyz), Juchzer und andere.
Die wohl umfangreichste Jodlersammlung wurde im Jahr 1902 von Josef Pommer veröffentlicht: 444 Jodler und Juchezer.
Jodeln weltweit
Auch ausserhalb des europäischen Alpenraums und der damit typischerweise assoziierten Musik wurde und wird das Jodeln als Stilmittel eingesetzt, dem US-amerikanischen DJ und „Jodelforscher“ Bart Plantenga zufolge in fast dreissig verschiedenen Musikrichtungen.
Insbesondere in den USA und Australien hatte das Jodeln im Bereich der Country-Musik einen grossen Stellenwert. Nachdem es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts in den Appalachen zu ersten Verbindungen zwischen alpenländischem Jodeln und anglo-amerikanischen Traditionen gekommen war, wurde in den 30er-Jahren durch Gastspiele österreichischer und Schweizer Künstler erstmals das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit am Jodeln geweckt. Zunehmend kam es auch zu Auftritten amerikanischer Künstler in diesem Stil. Gleichzeitig entstand im Bereich umherziehender Vaudeville- und Minstrel-Shows unter dem Eindruck afroamerikanischer Traditionen ein neuer Jodel-Stil, der auch vom Blues beeinflusst wurde. Dies wurde von weissen Old Time-Musikern aufgegriffen, 1924 veröffentlichte der Gitarrist Riley Puckett einen (damals sogenannten) „Hillbilly“-Song mit Jodlern. Der amerikanische Country-Sänger Jimmie Rodgers entwickelte 1927 das Blue Yodeling, wobei er Elemente des Blues und traditioneller weisser Musik mit Jodlern anreicherte. Sein erster Hit T for Texas (Blue Yodel) zog zahlreiche Nachfolger mit sich und inspirierte unzählige Musiker, die ihm nacheiferten.
Daneben stellt das Jodeln auch heute noch einen wichtigen Bestandteil der Western Music dar, unterscheidet sich dort jedoch deutlich von den Darbietungen im Bereich Country.
Im Jazz war Leon Thomas ein herausragender Vertreter. Er setzte das Jodeln als Stilmittel beim Scat ein und griff dabei auf ur-afrikanische Einflüsse wie das Jodeln der Pygmäen zurück, mit deren Gesangstraditionen er sich intensiv beschäftigt hatte. Wegweisend war in diesem Zusammenhang seine Zusammenarbeit mit Pharoah Sanders bei The Creator Has a Master Plan (1969).
Zeitgenössische Jodelkünstler sind z. B. die Schweizerinnen Christine Lauterburg, Christina Zurbrügg oder der Deutsche Thomas Hauser.
Quelle: Wikipedia